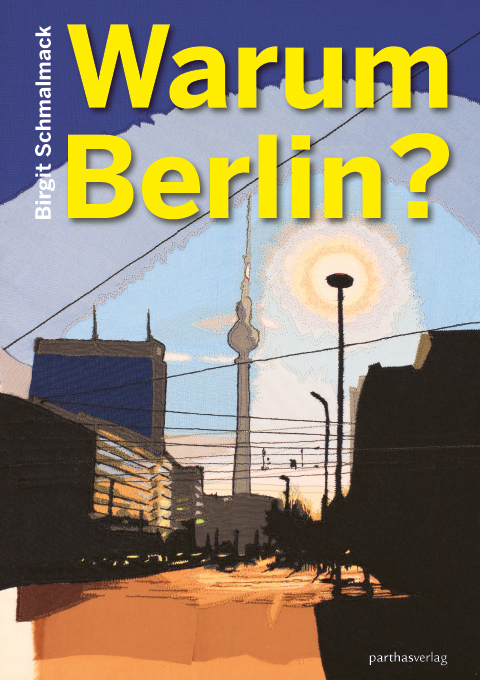Gespräch mit Ariel Nil Levy

„Ich sehe hier nur Möglichkeiten und Erweiterungen“, ist die Meinung von Ariel Nil Levy (43). Eine Einschätzung, die ich bisher nur von Leuten hörte, die erst kürzlich nach Berlin gekommen sind. Doch der Theatermacher aus Tel Aviv kennt die Stadt schon seit zwanzig Jahren. Mittlerweile hat er sogar die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. „Das war für mich einfacher als die ständige Verlängerung meines Visums“, meint er ganz pragmatisch. Auch wenn er dafür seinen israelischen Pass abgeben musste.
Ein Café am Maybachufer ist unser Treffpunkt. Hier sitze ich mit Ariel auf einer der beiden halbrunden Holzbänke, die aus einem einzigen Holzstamm gefertigt sind und etwas erhöht über den anderen Tischen auf einem Podest stehen. Die Kaffeemaschine dröhnt, der Laden brummt und immer wieder wehen neue Sprachen von all den anderen Sitzgruppen herüber. Ariels Outfit ist nicht besonders trendy; er trägt ein rotes Hemd zu senfgelber Hose und einen dunklen Kurzhaarschnitt zum Halbtagebart. Das einzig Auffällige an ihm sind seine golden lackierten Fingernägel. Freundlich aufmerksam lächelt er mich an. Bisher kennen wir uns noch nicht. Denke ich zumindest.
„Wir sprechen lieber auf Englisch“, wünscht er sich gleich zu Beginn. Obwohl er auch die Sprache der Einheimischen hier gut beherrscht. Die Begegnung in der Zweitsprache schaffe für alle die gleiche Ausgangsbasis. Zumindest theoretisch; doch mein Weltberliner-Englisch ist noch lange nicht so souverän wie das von Ariel. „Deutsch habe ich schon in Tel Aviv am Goethe-Institut gelernt.“ Eher ungewöhnlich für einen Israeli, oder? „Ich bin eher wegen Deutschland als trotz Deutschlands hier hergekommen. Es ist wie eine Exkursion zu meinen europäisch-jüdischen Wurzeln.“
Doch erst einmal hatte er andere Pläne. „Eigentlich war ich zum Studium auf dem Weg nach New York“, lacht er. Das scheiterte nicht nur am mangelnden Geld. Als er wieder einmal im Sommer 2001 Berlin besuchte, war die Entscheidung gefallen. Doch es brauchte noch ein paar Jahre des Herumreisens und des Studierens in Bonn, bis er 2007 anlässlich seiner Geburtstagsfeier zu seinem Dreißigsten in Berlin beschloss: Jetzt bleibe ich wirklich hier! Er schrieb an die Volksbühne mit der Bitte um einen Termin und bekam überraschenderweise ein Ja. Er durfte in einer Produktion des Regisseurs Dimiter Gottschef mitarbeiten. „After this, it’s history.“ Ab da war er im System. Er arbeitete am Schauspiel Frankfurt, am Schauspielhaus Wien, am Badischen Staatstheater Karlsruhe und vielen weiteren. Danach spielte er in vielen Kinofilmen mit und leitete ab 2010 mit seiner Ehefrau und Regisseurin Hila Golan ein Kollektiv in Berlin, das etliche Stücke herausbrachte, die ich sowohl inhaltlich wie künstlerisch unglaublich spannend fand.
Ariel beantwortet geduldig alle meine Fragen, die ich speziell zu diesen Produktionen habe, aber ich spüre, dass sie ihn eigentlich nicht wirklich interessieren. Denn sie sind ebenfalls Geschichte. Er will eigentlich viel lieber über das Jetzt reden und das dreht sich um Anali Goldberg. So der sprechende Name einer Dame, mit der er noch so viel vorhat. Er sprüht über vor Ideen. Immer wieder fällt das Wort queer.
Ich bin verwirrt. „Warst du nicht verheiratet?“ frage ich ganz direkt. „Das stimmt. Als ich mein Studium in Bonn aufnahm, lernte ich Hila kennen und verliebte mich in sie“, erzählt er bereitwillig. „Zuerst habe ich mich noch dagegen gewehrt. Aber meine Gefühle waren stärker als ich.“ Doch diese Phase in seinem Leben ist wieder vorüber. Er ist geschieden und seine Ex-Frau ist mit seinem Kind zurück nach Israel gegangen.
Ariel strahlt. „Ich war schon ein Clubkid in Tel Aviv. Mit 14 hatte ich bereits mein Outing.“ Jetzt erst fühlt er sich wieder ganz bei sich angekommen. „Schon in Israel habe ich als Drag-Queen auf der Bühne gestanden. Im Moment spiele ich gerade wieder in einem Club, der Wilden Renate“, erzählt er mir begeistert. Nächste Verwunderung meinerseits: „Ich war da und hab dich gar nicht gesehen.“ Gerade letzte Woche hatte ich die Kunstinstallation mit dem Titel Overmorrow besucht, bei der jedem der Künstler:innen ein Kellerraum zur Verfügung gestellt wird, den sie bespielen dürfen. „Neben dem blumenberankten Klo, das war mein Raum.“ „Da saß doch eine dickbusige, ältere, grell geschminkte Frau, die von den unerfreulichen Erfahrungen mit ihrem Ehemann erzählt, den sie deswegen leider in eine Aubergine verwandeln musste“, erinnere ich mich. „Ja, genau, das war ich!“, lacht Ariel sichtlich stolz. „Never!“ Ich verstecke meinen leichten Schock unter lautem Lachen. Ariel hat riesigen Spaß am Spiel mit den Zuschauer:innen, die im Fünf-Minutentakt zu ihm hereinstolpern und die unterschiedlichsten Reaktionen auf seine Performance zeigen, und so auch an seiner Überraschung für mich. Das ist also Anali Goldberg. Sie wirkt abschreckend, sympathisch, irritierend und entwaffnend zugleich. Ariel nennt das: „Postdramatisches Theater mit Stilelementen aus der Dragszene.“ Ein Mann in der Mitte seines Lebens, der mit leicht dilettantisch anmutender Experimentierlust an seine Jugend anknüpft, um auf schrill-witzige Art zum Nachdenken anzuregen, auch das lässt die Spielwiese Berlin zu. Oder das Märchenland Berlin. „Wenn meine Freunde in Israel zu mir sagen, dass ich in LalaLand lebe, haben sie vollkommen Recht.“
Als ich ihn frage, ob er nicht auch wie viele eine Verengung der Freiräume für die Kunst sehe, widerspricht er mir ganz vehement: „Ich sehe nur eine Verbesserung und eine Steigerung. An allem, an Verbundenheit, an Unterstützung, an Vertrauen, an Gemeinschaft.“ Ariel liegt eben perfekt im Trend. Er zeigt mir sein Handy. „Gerade heute habe ich eine Mail bekommen. Eine neue Förderung wird ausgeschrieben, speziell für Ausländer:innen, die sich mit den Themen Diversity, Queerness und Gender auseinandersetzen.“ Den Förderantrag könne man sogar auf Englisch einreichen. Wenn das nicht ein Beweis dafür ist, dass der Senat die Zeichen der Zeit verstanden hat.
Als Ariel neulich mit Freunden an einem der Seen zusammen saß, blickten sie verwundert um sich und stellten fest: „Wir sind eigentlich alle hier.“ Ob mit Deutschkenntnissen oder nicht, alle linken, queeren Künstler aus Tel Aviv fänden sich mittlerweile in Berlin wieder.