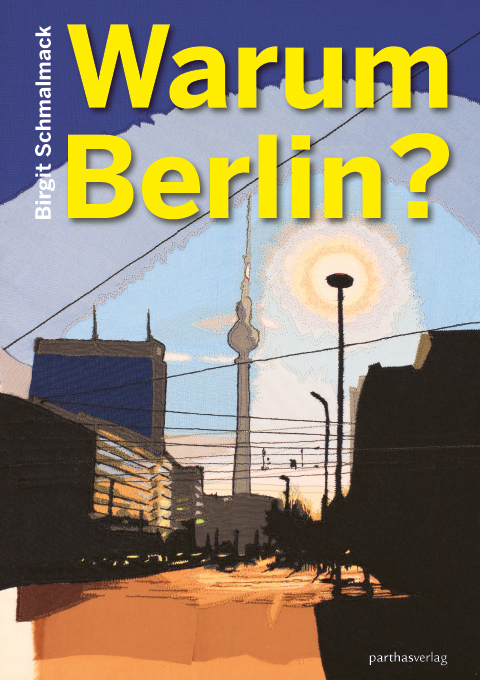ALLERSANDERSPLATZ steht über dem Haus der Statistik am Alexanderplatz. Ein Motto für Berlin? Wenn ich wieder einmal aus dem geordneten, bürgerlichen Hamburg in diese quirlige Stadt komme, ist stets mein Eindruck: Hier ist alles etwas anders. In dieser Stadt, die trotz umfangreicher Bautätigkeiten in den letzten Jahrzehnten nie fertig zu werden scheint. Immer wieder werden neue Kanalrohre hoch oben über die Straßen gezogen. Diese blauen oder rosa Rohrleitungen setzen ständig neue unübersehbare Zeichen der immerwährenden „Baustelle Berlin“ ins Straßenbild. Es scheint mir stets, als würden sie zugleich einen speziellen Berliner Mut zu pragmatischer Hässlichkeit ausdrücken, dem jeder Versuch von Beschönigung fern liegt. Doch nicht nur das ist anders. Eine ganz besondere Energie scheint über dieser Stadt zu liegen. An jeder Straßenecke wartet die nächste Überraschung. Hier eine Kunstausstellung am Straßenrand, dort ein Tanzkurs unter den Säulengängen eines Museums, hier ein Klavierkonzert an einer Straßenkreuzung, dort eine Feuershow auf einem Skaterplatz. Die Menschen scheinen ihre Stadt selbst zu gestalten und nicht darauf zu warten, dass jemand kommt, der etwas für sie veranstaltet. Gleichzeitig sind die Wunden, die die Geschichte in diese Stadt geschlagen hatte, trotz der zahlreichen Verschönerungen der letzten Jahre immer noch unübersehbar. Der Osten mit seinen kilometerlangen Plattenbauten, die einst leere Mitte, nun mit Reihen aus Bürotürmen als in Stein gegossenem Mauerersatz versehen, die vergleichsweise dezenten Erinnerungen an den Mauerstreifen aus zwei Kopfsteinreihen im Asphalt, die verfallenen neben den sanierten Industriekomplexen, die sowjetischen Ehrenmale und die Mahnmale, die die Zeit zwischen 1933 und 1945 reflektieren. Demgegenüber prangen die Regierungsneubauten in ihrem monumentalen „Neo-Brutalismus light“. Zwar muss man heute genauer hinschauen, aber die Zeugnisse der Vergangenheit sind noch vorhanden, auch im Gedächtnis der Stadtgesellschaft.
Doch diese Stadt ist eigentlich nichts ohne ihre Bewohner:innen. Sie hat weder besonders schöne Architekturen, noch besonders bemerkenswerte Landschaften. Man könnte sagen, sie sei eher bescheidener Durchschnitt. Einzig die Berliner:innen, der Mix aus alten und neuen Stadtbewohnenden, macht diese Stadt zu dem, wofür sie von vielen geliebt wird. Zur betonten Lässigkeit junger Berliner:innen kommt der raue Charme der Alteingesessenen. Diese unnachahmliche Mischung ist das eigentliche Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt. Die coolen Leute kamen und kommen nach Berlin. Und genau die Richtigen bleiben hier.
Diese Tendenz gab es auch schon vor dem Fall der Mauer. In den Westteil der Stadt zogen diejenigen, die etwas anderes wollten als das beschauliche Kohl-Deutschland. Wehrdienstverweigerer, Kunstschaffende oder Andersdenkende zog es nach Berlin. Sie landeten oft in dem zum Sanierungsgebiet erklärten Stadtteil direkt an der Mauer: in Kreuzberg 36. Hier wurde in kein Gebäude mehr Geld gesteckt, sie waren bis zum Abriss dem Verfall preisgegeben. Hier trafen die Exil-Westler:innen auf die anderen „Neu“-Berliner:innen, die sich keine bessere Bleibe leisten konnten: die so genannten „Gastarbeiter“. Auf der Ostseite waren die Zustände ähnlich, mit einem Unterschied: Hier fehlte die Durchmischung mit einer migrantischen Bevölkerung. In Ostberlin war neben dem Stadtteil Mitte auch der Prenzlauer Berg zum Sanierungsgebiet erklärt worden. In die unattraktiven, unsanierten Altbauten zog es oft die missliebigen Ostberliner:innen, die Kunstschaffenden und Oppositionellen der DDR. Diese Ostbezirke mit Straßenzügen voller ungehobener Altbauschätze waren die ersten in Berlin, die eine komplette Durch-Gentrifizierung vermelden konnte. Heute findet sich hier eine fast homogene Bevölkerung aus jungen, gut verdienenden Familien mit kleinen Kindern.
In Kreuzberg ist das Bild eines mit mehr Schattierungen. Hier bildet eine Mischung aus schon gentrifizierten Kiezen, Mietshäusern mit altem Mieterbestand, langjährigen türkischen Ladengeschäften, ehemals besetzten Häusern und Bauwagenplätzen bis heute den Nährboden für die sprichwörtliche Widerständigkeit der Berliner:innen. Sie protestieren gerne und viel. Kein Wunder, dass sich um Kreuzberg herum die internationale Szene bevorzugt tummelt. Während im Prenzlauer Berg angeblich „Schwaben“ gerne Quartier beziehen, ein oft zitiertes Klischee, das sich hartnäckig hält.
Doch meine Zuneigung zu Berlin blieb lange eine Fernbeziehung. Nur für wochenweise Trips zog ich in die Stadt und meinte schon bei der ersten Fahrt auf meinem Rad diese Energie der Stadt zu spüren. Immer wenn ich Berlin einen Besuch abstattete, war das Stimmengewirr noch größer geworden. Bald fiel mir keine Sprache mehr ein, die man auf den Berliner Straßen nicht hören konnte. Es entwickelte sich hier eine internationale Szene. Doch das Besondere an diesem Allesandersplatz war: Hier schienen sich, anders als früher, keine neuen Inseln aus einzelnen „Parallelgesellschaften“ zu bilden, die sich abmühten Eingang in das deutsche System zu erlangen – meist mit unbefriedigendem Ausgang – sondern eine internationale Szene, die mit Englisch die Verständigung und Zusammenarbeit über alle Sprach- und Kulturgrenzen hinweg ausprobierte. Das war etwas Neues, Anderes. So wuchs die Idee, mir dieses Zusammenleben genauer anzusehen.
Was macht diese Stadt so attraktiv für so viele Menschen? Ein Selbstversuch soll das herausfinden. Für ein Jahr ziehe ich nach Berlin. Ist es wirklich so einfach Zugang zu der internationalen Szene in Berlin zu bekommen, wie es immer heißt? Es könnte schwierig werden. Aus Hamburg kenne ich schließlich die deutschen Großstadtgepflogenheiten. Eine weitere Einschränkung beschäftigt mich. Ich kann zwar Deutsch, aber mein Englisch ist eingerostet. Sollte das ein Problem werden in einer deutschen Stadt?
Als jemand, der sich bisher jedes Jahr wochenweise in der Hauptstadt ausschließlich in der Theaterwelt umgetan hatte, hatte ich nur Kontakte in diese Szene, doch die war pandemiebedingt geschlossen. Würde ich dennoch Leute finden, die bereit wären mir von ihren Erfahrungen mit der Stadt Berlin zu erzählen? Denn das war mein Wunsch: Ich wollte möglichst viele verschiedene Experten des Wanderungsalltags kennenlernen. Wie erleben sie diese Stadt? Wirkt sie immer noch so tolerant, offen und cool, wenn man als Neuankömmling den Alltagstest wagt? Oder stellt sie unüberwindliche Hindernisse in den Weg, wenn es gilt Wohnung, Job, Zugang und Freunde zu finden? Lassen sich die unterschiedlichen sprichwörtlichen Projekte in dieser Stadt wirklich so leicht umsetzen, wie überall behauptet wurde? Haben die Neuankömmlinge tatsächlich das Gefühl, an der sozialen Plastik der Stadt mitwirken zu können? Wird ihnen echte Teilhabe erlaubt?
Deutschland galt ja bisher keineswegs als aufgeschlossenes Einwanderungsland. Warum scheint dies nun in Berlin zu gelingen? Was macht die Stadt anders? Und ich wage sogar einer Utopie nachzuhängen: Wird hier gerade in einem winzigen Testfeld ein europäisches, ein kosmopolitisches Zusammenleben ausprobiert? Oder wiegt sich hier bloß eine akademische Elite in der beschaulichen Illusion ihrer grenzenlosen Toleranz, während die von ihr mit verursachte Gentrifizierung Gruppen der Gesellschaft exkludiert und an die Ränder verschiebt? Erfüllt New Berlin in Wahrheit nur die Ziele einer Marketingstrategie zur Entwicklung neoliberaler Wirtschaftsräume zahlloser Ich-AGs in der Medien- und Kreativbranche? Kann der Wunsch des sich ständig neu Erfindens und Transformierens überhaupt die Alltagsinteressen der Stadtbürger:innen, die für ihr tägliches Auskommen sorgen müssen, mitdenken? Aus der Perspektive der Wahlberliner:innen würde vielleicht klarer werden, wohin die Entwicklung führen könnte oder sollte.
Nur ein prägnanter Arbeitstitel für mein Projekt fehlt mir noch. Eine australische Künstlerin hat wenig später die zündende Idee und schlägt mir „Worldberliner“ vor. Perfekt! Schließlich schaffen diese Weltberliner:innen eine Verbindung zwischen Berlin und der Welt. Sie stehen mit einem Bein in einem Teil der Erde und mit dem anderen in Berlin. Sie sind Weltbürger:innen und sorgen mit ihrem Hiersein dafür, dass Berlin immer mehr zu einer Weltstadt wurde und wird.